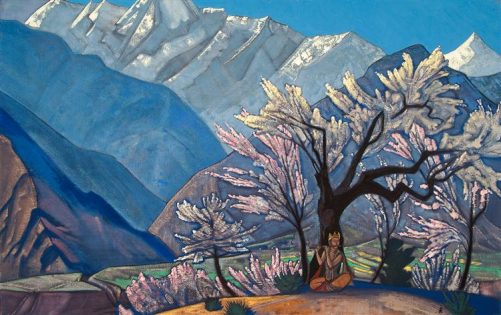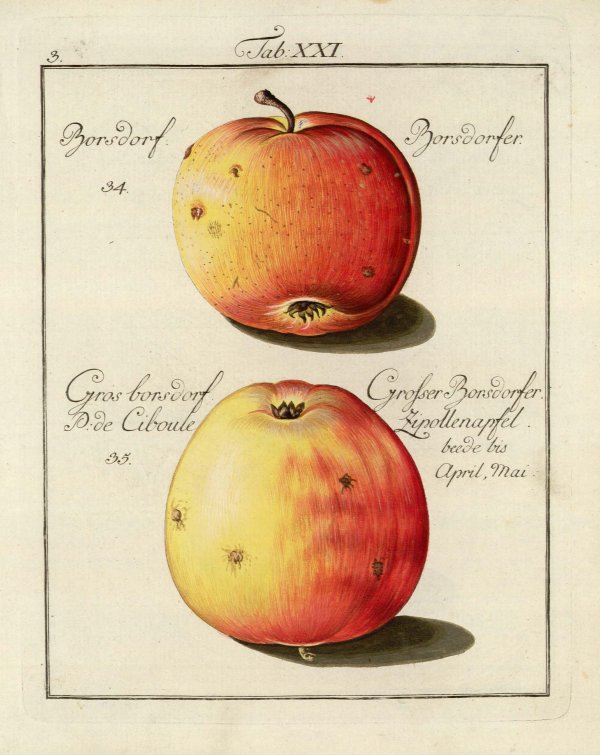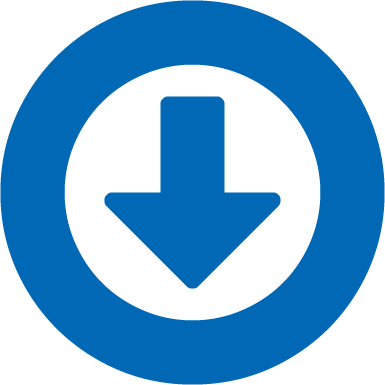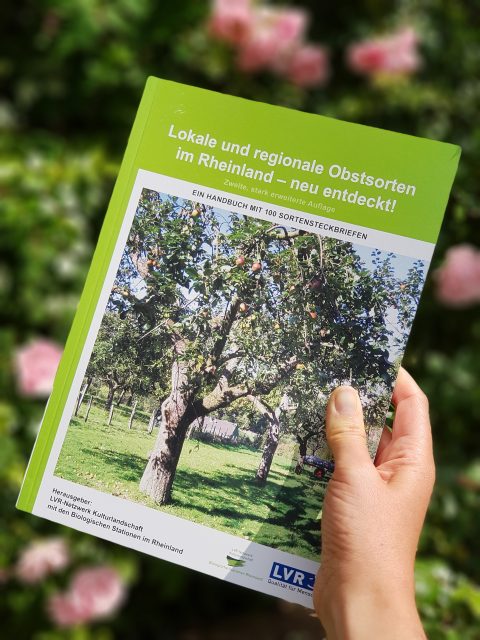Bedrohtes Paradies
Wiesen
Bedrohtes Paradies
Drei, zwo, eins… keins (mehr da)?

Artenreiche Fettwiese im Spätfrühling. Zahlreiche Wiesenkräuter gelangen nun zur Blüte. Bild: Volker Unterladstetter
Nicht nur die biologische Vielfalt von Wiesen ist atemberaubend. Leider halten artenreiche Wiesen auch den traurigen Rekord in der Gruppe der gefährdeten Ökosysteme. Geschätzte 92% des artenreiches Graslands sind in den letzten Jahrzehnten in NRW verschwunden, Tendenz weiter fallend. Mittlerweile sind die letzten Wiesen des Flachlands von vollständiger Vernichtung bedroht. Wenige Jahre intensivierter maschineller bzw. chemischer Nutzung reichen aus, um aus einer Jahrhunderte alten artenreichen Wiese einen monotonen Grasacker zu machen. Die Anwendung von Kunstdünger und Gülle steigert zwar kurzfristig den Ernteertrag auf Wiesen, allerdings auf Kosten der Vielfalt. Die allermeisten Pflanzen und Tiere sterben im Rahmen solcher Produktivitätssteigerungen auf den Flächen aus. Ist die Wiese dann erst einmal an Arten verarmt, dauert es viele Jahre, um daraus wieder eine blütenreiche Magerwiese zu entwickeln.
Was wir tun
Die Naturschutzstation engagiert sich in ihrem Arbeitsgebiet in Köln und Leverkusen für den Erhalt der letzten artenreichen Wiesen. In den meisten Fällen sind diese Wiesen kleine Reliktflächen, die abseits der großen Agrarflächen in Naturschutzgebieten überdauert haben. Größeres zusammenhängendes Wiesenland mit einer mehr oder minder intakten Artengarnitur findet sich heute nur noch in den Rheinauen.
Neben dem dringenden Schutz der Altwiesen arbeitet die Naturschutzstation in verschiedenen Projekten an der ökologischen Aufwertung bzw. Wiederherstellung artenarmer Graslandflächen, um den zahlreichen gefährdeten Pflanzen und Tieren zusätzlichen Lebensraum zur Verfügung zu stellen. Gerade wenig genutzte öffentliche Grünflächen eignen sich an vielen Standorten dazu, die fast ausgestorbenen artenreichen Wiesen von einst wieder in unsere Landschaften zurückzuholen. In Köln haben wir mit dem Konzept der „StadtNaturParke“ einen Vorschlag entwickelt, wie Erholungs- und Freizeitnutzungen in größeren Grünanlagen mit bunten Heuwiese und anderen naturnahen Biotopelementen verbunden werden können. Und auch in Leverkusen werden wir in den kommenden Jahren verstärkt im Bereich des kommunalen Grüns tätig sein.